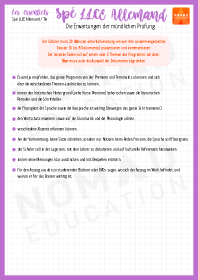Stefanie Zweig und "Nirgendwo in Afrika"
Stefanie Zweig (19/09/1932–25/04/2014) schrieb den autobiographischen Roman "Nirgendwo in Afrika" (1995). Dieser wurde 2001 von der Regisseurin Caroline Link als deutscher Spielfilm adaptiert.
Handlung
Die jüdische Familie Redlich flüchtet im Jahr 1938 mit ihrer kleinen Tochter vor dem NS-Regime aus dem Deutschen Reich nach Kenia. Der Roman basiert auf einem Brief vom 20/07/1938 von Walter an seine Frau Jettel, kurz vor ihrer Anreise.
Themen des Exils
Die Lebensverhältnisse im Exil
Das Leben im Exil bringt verschiedene Herausforderungen mit sich, die sich in mehreren Bereichen zeigen:
- Kulturelle Anpassung: Sich an die Menschen und deren Kultur anpassen. "Regina wird die ersten Schwarzen sehen", "es dauert lange, bis man die Mentalität versteht"
- Sprachliche Herausforderungen: Eine neue Sprache lernen - "als ich genug Suaheli gelernt habe...", "für die besseren Positionen muss man Englisch kennen"
- Klimatische Bedingungen: Das heiße Klima und deren Folgen vertragen - ohne Kühlschrank schwierig, anders essen, ungeteerte Straßen, Krankheiten wie Malaria
- Persönliche Veränderung: Sich selbst anders denken - "du musst lernen, Kränkungen nicht mehr wichtig zu nehmen"
- Berufliche Neuorientierung: Einen anderen Beruf ausüben - Walter wird Farmer und war Rechtsanwalt
Die Beziehung zu Deutschland im Exilland
Die Verbindung zur Heimat bleibt trotz der Entfernung bestehen und zeigt sich in verschiedenen Aspekten:
- Familiäre Verbindungen: Über die Mutter von Jettel - "dass ein Mensch ohne Hoffnung noch an andere denken kann"
- Informationsquellen: Walter erfährt durch Briefe, Rundfunk oder durch Deutsche in Kenia über Deutschland und seine Freunde (Verhaftungen)
- Politische Realität: "wie die Nazis an deinem Tisch das Hitlerbild anschwärmen"
- Kultureller Kontrast: Auf eine indirekte Weise - "Owuor weiß nicht, wie man Menschen kränkt; vor allem kämen sie nie auf Idee, Menschen einzusperren"